
Shutterstock.com
Beziehungen
Geschwister: Zoff bis ins hohe Alter
Konflikte unter Geschwistern können ein Leben lang andauern. Wie durchbricht man alte Muster, damit im Erwachsenenalter ein gutes Miteinander möglich ist?
Es ist der 75. Geburtstag der Mutter, alle sind gekommen. Da sagt der erwachsene Bruder zur Schwester: «Wäre schön gewesen, du hättest dich um das Geschenk gekümmert – anstatt wie immer alles mir zu überlassen.» Die Schwester antwortet: «Was musst du schon wieder so giftig sein?» Und der Vater ruft: «Jetzt hört doch mal auf, wir wollen keinen Streit!» Christina Gnägi schmunzelt, als sie die Szene erzählt bekommt. Diesen unterschwelligen Konflikten auf den Grund zu gehen, sie bestenfalls aufzulösen, gehört zu ihrem Alltag. Christina Gnägi ist Mediatorin mit Praxis in Seengen AG und coacht streitende Geschwister.
Eskalation im Erwachsenenalter
Die Beziehung zwischen Geschwistern ist einzigartig, denn sie begleitet uns ein Leben lang. «Sie ist eine Primärbeziehung und von der Bedeutung ebenso hoch zu gewichten wie die Beziehung zu den Eltern», sagt Jürg Frick. Der Psychologe und emeritierte Professor der Pädagogischen Hochschule Zürich ist im deutschsprachigen Raum einer der wenigen Forscher, die untersuchen, wie sehr uns die Beziehung zu Schwester und Bruder ein Leben lang prägt. «Vor allem in unseren ersten zwanzig Jahren haben Geschwister einen sehr grossen Einfluss», weiss Jürg Frick. Wie wir Konflikte lösen, Nähe und Zuneigung zeigen – dies alles schauen wir nicht nur von unseren Eltern ab, sondern auch vom grossen Bruder und der kleinen Schwester. Der meist geringe Altersabstand sorgt dabei für besonders viel Nähe und tiefe Gefühle. Aber auch für starke Emotionen, wie Eifersucht, Ablehnung und Konkurrenz. Konflikte sind somit vorprogrammiert.
Oft eskalieren Geschwisterkonflikte erst im Erwachsenenalter richtig – weil es dann nicht mehr nur um den Streit zwischen zwei verschwisterten Personen geht, sondern weitere Parteien involviert sind, wie etwa Partnerinnen und Partner mit zusätzlichen Interessen. Zudem werden viele Kindheitsthemen mit ins Erwachsenenalter genommen: vermeintliche Verletzungen, das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein.
Spielen in der Kindheit oft die Eltern eine ausgleichende Rolle zwischen den Geschwistern, müssen Erwachsene diese Aufgabe später selbst erfüllen. Doch wer sich in der Rushhour des Lebens befindet – eigene Kinder hat, um die es sich zu kümmern gilt, Eltern, die nun Unterstützung brauchen, einen Job, der fordert – der ist oft zu dünnhäutig, um Zwist mit Bruder oder Schwester aus eigener Kraft zu lösen. Dies ist zumindest Christina Gnägis Erfahrung. So ist es nicht erstaunlich, dass sich in ihrer Praxis vor allem Menschen ab 40 Jahren einfinden. Manche kommen, weil sie mit ihren Geschwistern wieder bessere Freunde werden wollen. Anderen geht es nur um eine friedliche Koexistenz.
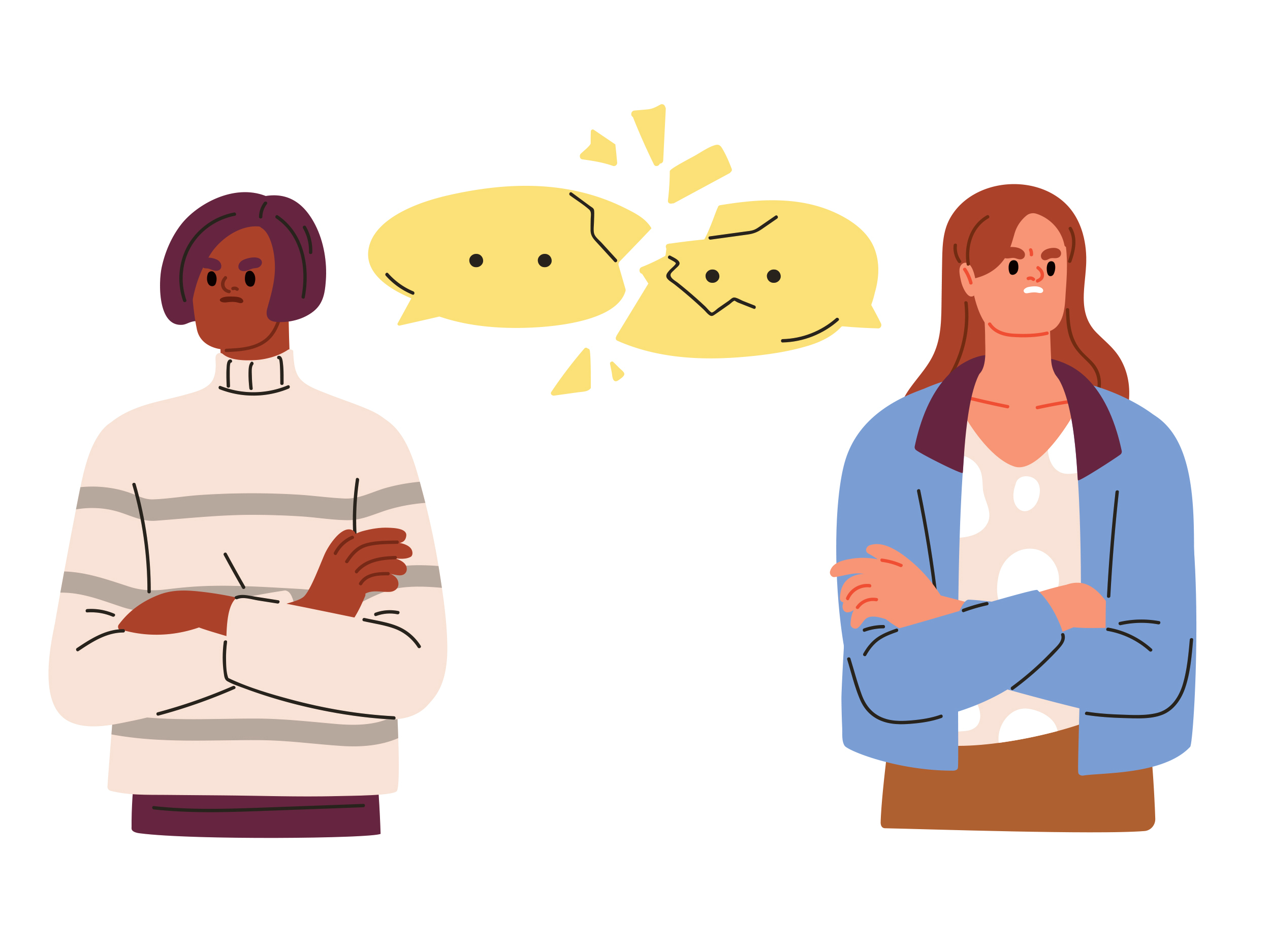
Da sind zum Beispiel die Geschwister, die sich nur wenige Mal im Jahr sehen, aber bereits im Sommer bei Christina Gnägi um einen Termin bitten, damit das nächste Weihnachtsfest nicht wieder eskaliert.
Es geht um Konkurrenzgefühle – die Jüngere, die sich zeitlebens nicht ernst genommen fühlt; der Ältere, der meint, alles laste auf ihm. Um Neid – weil die Lebenswege so unterschiedlich verlaufen sind. Um alte Geschlechterrollen, in denen man verharrt – die Schwester, die sich um die Pflege der Eltern kümmert, der Bruder, der nur die Rechnungen bezahlt. Um Frust über ungleiche Erbschaften und generell um das Gefühl, ungleich behandelt zu werden, seit Kindesbeinen an. «Viele Geschwister schleppen bis ins hohe Alter einen grossen Leidensdruck mit sich herum», sagt Cordula Ziebell. Die Gestalttherapeutin und Heilpraktikerin bietet mit ihrer Schwester Barbara Ziebell, Trainerin für Seminardidaktik, seit 15 Jahren in Deutschland Geschwistern Workshops und Coachings an. Ihre Klient:innen berichten häufig vom Gefühl der fehlenden Augenhöhe und davon, sich nicht gesehen zu fühlen. Hinter all dem stecke der Wunsch nach Wertschätzung und Anerkennung.

Was können Eltern tun, wenn sich Kinder dauernd fetzen? Die Familienberaterin Maya Risch weiss Rat.
Frau Risch, wie lässt es sich vermeiden, dass Geschwister ständig streiten? Muss man das vermeiden?
Klar, Geschwisterstreit ist laut, intensiv und fordert Eltern heraus. Aber Kinder lernen auch viel: teilen, Kräfte erproben, verhandeln, für eigene Bedürfnisse einstehen. In meinen Kursen lade ich Eltern dazu ein, Geschwisterstreit positiv zu sehen. Und sich vom Gefühl zu lösen: «Ich mache was falsch, wenn meine Kinder viel streiten.»
Wie aber reagiere ich als Elternteil, wenn sich die Siebenjährige und der Neunjährige in den Haaren liegen?
Zunächst würde ich ruhig fragen: «Habt ihr Streit?» Manchmal nehmen wir das laute Gezeter als Streit wahr, dabei verhandeln die Kinder nur laut und brauchen keine Intervention von uns.
Und wenn es handfest zu- und hergeht?
Dann setzt bei Eltern der Schutzinstinkt ein und sie haben das Gefühl, sofort handeln zu müssen. Hier rate ich: gelassen bleiben und beobachten. Eltern haben die Tendenz, Kinder schnell beruhigen zu wollen. Dabei sind oft wir selbst aufgebracht und müssen zunächst für uns klären: «Wie kann ich mein Nervensystem wieder beruhigen?» Und: «Wofür bin ich eigentlich verantwortlich?»
Na ja, zum Beispiel dafür, dass die Kinder sich nicht die Köpfe einschlagen?
Ja, wird es grob, sind Gegenstände im Spiel oder ist der Altersunterschied gross, würde ich schnell eingreifen. Eltern sollten sich aber bewusst machen: Sie sehen nur einen kleinen Teil des Konflikts und wissen meist nicht, wie es angefangen hat. Deshalb lieber nicht Partei ergreifen. Denn rutschen wir in die Rolle des Schiedsrichters, haben wir verloren – weil mindestens eines der Kinder unsere Position als ungerecht empfinden wird. Das Ziel lautet deshalb: Begleiten statt Schlichten.
Wie begleite ich souverän?
In einem hitzigen Moment hilft oft eine physische Trennung mit der Ansage: «Ich lasse nicht zu, dass ihr euch verletzt! Wir brauchen jetzt alle eine Pause und besprechen später, was passiert ist und wer was braucht.» Geraten Geschwister immer wieder aneinander, kann es sich lohnen, ihre Beziehung durch gemeinsame Aktivitäten zu stärken, sodass sie sich als Team erleben. Denn häufig stecken Konkurrenzgefühle hinter Dauerstreitigkeiten.
Was sollten Eltern vermeiden?
Einzelne Kinder zu beschuldigen oder dauernd einzuschreiten – denn so lernen Geschwister nicht, Konflikte selbst zu lösen. Auch «Hört auf!» zu rufen, können Eltern sich sparen. Stattdessen lieber zweimal durchschnaufen und sich klar machen: Ständige Harmonie in der Familie ist eine Utopie – auch wenn sich das vor allem Frauen oft wünschen. Meine Buben, 19 und 16 Jahre alt, sagen heute: «Wir haben es so gut miteinander, weil wir früher so viel gestritten haben.» Da mag was dran sein. Auch wenn es für mich phasenweise schwer auszuhalten war.
Maya Risch ist Familienberaterin und bietet unter anderem Elternkurse zu Geschwisterstreit an.
Alte Rollenmuster
Eine der häufigsten Ursachen für Geschwisterzwist im Erwachsenenalter sind alte Rollen- und Familienmuster: die Laute, der Emotionale, die Harmonische, der Unzuverlässige – übernommene Rollen und zugewiesene Eigenschaften, in denen wir oft hängen bleiben. Denn Eltern und Geschwister sehen uns tendenziell immer als das Kind von damals – egal, wie alt wir sind, was wir geleistet oder uns aufgebaut haben. So kracht es an Familienfesten auch deshalb häufig, weil Menschen in nicht aufgearbeitete Muster zurückfallen, die sie einengen. Die Frage lautet dann: Sprechen wir als Geschwister miteinander oder aus den uns zugeschriebenen Rollen? Die Kindheit hat man intensiv miteinander verbracht, aber im Erwachsenenalter bekommt man vieles nicht mehr voneinander mit – und merkt so nicht, dass Bruder oder Schwester längst woanders stehen.
Doch warum verfallen wir überhaupt in alte Rollenmuster? «Jedes Kind versucht in seiner Familie einen Platz zu finden, wo es Resonanz erfährt», sagt Jürg Frick. Ein Kind mit einem älteren Geschwister hat dabei bereits ein anderes Kind mit einer bestimmten Rolle vor sich. Von diesem versucht es sich abzugrenzen, seinen Platz zu finden. Spielt das ältere zum Beispiel ein Instrument und das jüngere überholt es darin, hört das ältere oft damit auf – weil es seinen Platz verliert. «Diese Rollen sind Kindern natürlich nicht bewusst», so der Psychologe. «Es ist eher ein Austesten auf der Suche nach Anerkennung.» Nach und nach verinnerlichen sich diese Rollen jedoch und ziehen sich bis ins Erwachsenenalter fort. Am Familientisch rutschen wir dann wieder in die alten Rollen – wie die Geschwister in der Eingangsszene: Der grosse Bruder, der alles organisiert. Die kleine Schwester, die sich ins gemachte Nest setzt.

Jürg Frick, Psychologe und Geschwisterforscher
Der Einfluss der Eltern
Mediatorin Christina Gnägi regt ihre Klient:innen deshalb gerne zum Nachdenken an: Kenne ich meine Geschwister überhaupt? Kann ich annehmen, dass sie andere Qualitäten haben als ich? Dass sie sich weiterentwickelt haben? Auch die Eltern haben grossen Einfluss auf Geschwisterbeziehungen. «Wir wissen aus vielen Studien, dass elterliches Verhalten enorm dazu beiträgt, Konflikte unter Geschwistern anzuheizen oder zu mildern.» Häufig geschehe es zwar unbewusst, wenn Mutter oder Vater ein Kind bevorzugen – «aber Kinder haben feine Antennen und spüren dies genau.»
Cordula und Barbara Ziebell stellen ebenfalls den elterlichen Einfluss in ihrer täglichen Arbeit fest: «Eine gute Geschwisterbeziehung im Alter hängt weniger von Altersabstand, Temperament, Reihenfolge, Geschlecht oder Lebensumständen ab, sondern davon, wie Eltern mit Geschwisterkindern umgehen – wie sie ihnen beibringen, Konflikte zu lösen und dies vorleben.» Aber auch, ob sie jedes Kind als eigenständiges Wesen behandeln, sie nicht miteinander vergleichen.
«Konflikte und Streitigkeiten verhindern müssen Eltern aber nicht – und können es auch gar nicht vollständig», betont Jürg Frick. Denn Streit und Konkurrenz haben auch gute Seiten: «Vergleichen sich Kinder untereinander, wirkt dies wie ein Motor auf ihre Entwicklung.»

Verabschieden sollten sich Eltern jedoch von dem Versuch, ihre Kinder gleich zu behandeln. «Das ist schlicht nicht möglich», so der Psychologe. «Denn bei Geburt von Kind Nummer zwei sind Eltern nicht mehr in der gleichen Situation wie bei Kind Nummer eins. Sie haben sich weiterentwickelt, die Familiensituation ist eine andere.» Gleichbehandlung sei deshalb eine Illusion. Und auch gar nicht nötig. Denn Kind Nummer zwei hat vielleicht ohnehin ganz andere Bedürfnisse als Kind Nummer eins. Und ein weinender Vierjähriger möchte anders getröstet werden als ein weinender Zwölfjähriger. Es gehe deshalb nicht darum, Kinder gleich zu behandeln, sondern entsprechend ihren Bedürfnissen. Und sie mit ihrer ganzen Individualität anzunehmen, mit allen Stärken und Schwächen.
Auch wenn Kinder zusammen aufwachsen, ziehen sie aus gemeinsamen erlebten Situationen nicht dieselben Schlüsse. Erwachsene Geschwister müssen sich deshalb bewusst machen, dass sie zwar in derselben Familie gross geworden sind, jedoch mit unterschiedlichen Erfahrungen. Wer im Streit liegt, hat dabei besonders häufig völlig verschiedene Wahrnehmungen und Erinnerungen – «was zu unterschiedlichen Erwartungen, Verletzungen, Rollenund sogar Schuldzuschreibungen führen kann», sagt Barbara Ziebell.
Was erwachsenen Geschwistern hier hilft: Sich in einem offenen Gespräch gegenseitig Erinnerungen und Situationen aus der Kindheit zu erzählen. Zuhören, ohne zu unterbrechen, entgegennehmen, was der Bruder oder die Schwester empfindet. «Das ist die anstrengendste Phase während der Mediation, weil beide ehrlich sein müssen», sagt Christina Gnägi. Sie müssen ihre eigenen Anteile am Konflikt reflektieren, nicht aufs Rechthaben beharren, gegenseitige Erwartungen hinterfragen. Unter Umständen emanzipieren sich Geschwister so von alten Rollen, lernen sich neu kennen und stellen fest: «Meine flatterhafte Schwester ist ja längst erwachsen! Sie leitet ein Unternehmen und ist alles andere als unzuverlässig.»
Sich bei latentem Geschwisterstreit Hilfe von aussen zu holen, lohne sich immer, findet Christina Gnägi. Sie erzählt von einem 60-jährigen Geschäftsmann, der sich nach der letzten Mediationssitzung mit seinen Geschwistern eingestand: «Jetzt mussten wir so alt werden, bis wir uns Zeit genommen haben, das erste Mal richtig miteinander zu reden.» Auch Barbara und Cordula Ziebell sind überzeugt: «Sich mit der eigenen Geschwisterdynamik zu befassen und bestenfalls Frieden zu schliessen, lohnt sich bis ins hohe Alter.» Ihre bisher älteste Teilnehmerin war 82 Jahre alt.





