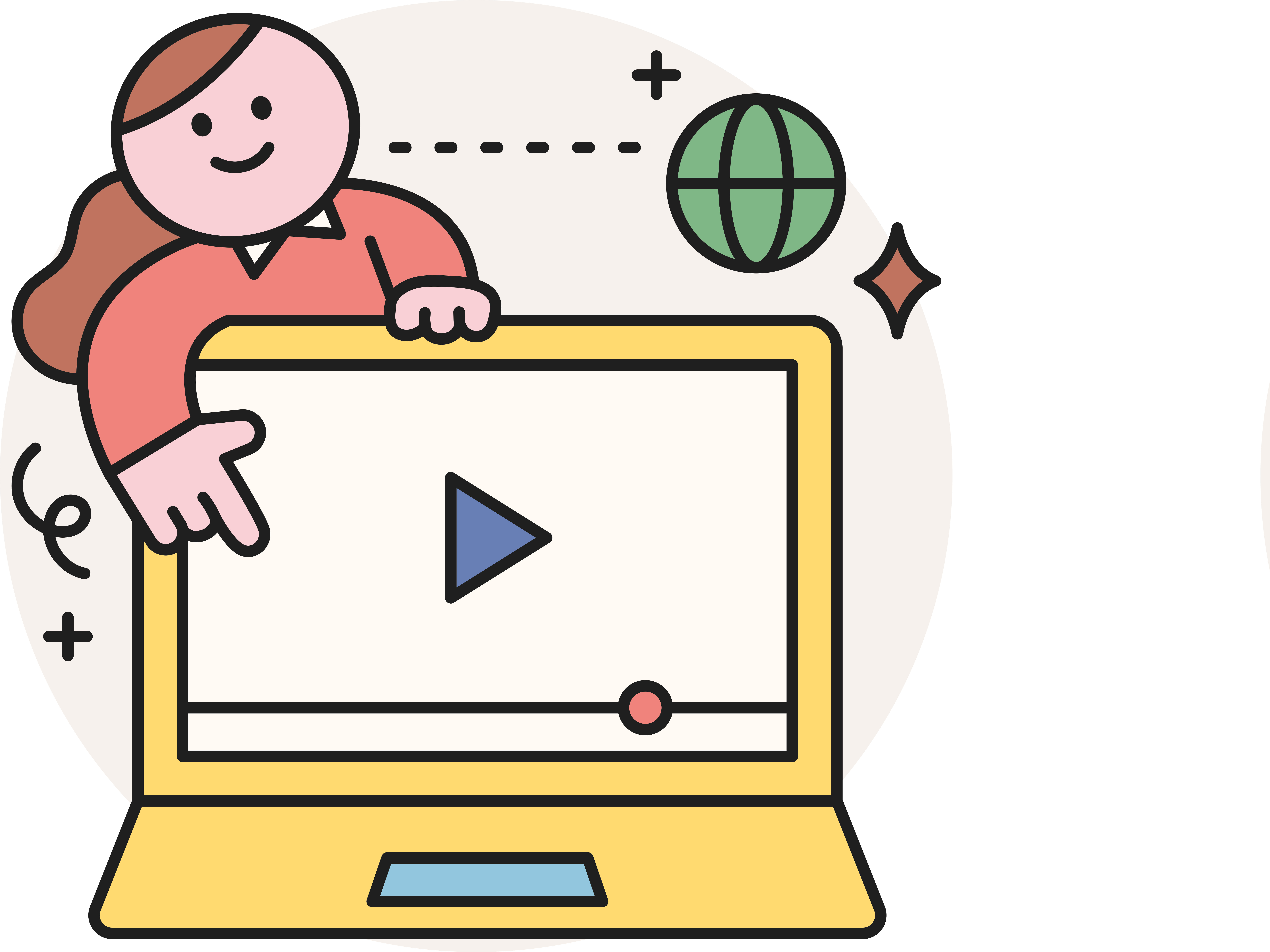
shutterstock
Lernen
Digitales lernen, aber smart
Von Yvonne Kiefer-Glomme
Lern-Apps und KI sind spannend – doch wie viel Unterstützung tut gut, und wo beginnt die Abkürzung?
Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren befinden sich in einer entscheidenden Entwicklungsphase, in der viele digitale Routinen entstehen. Um kritisches Denken zu fördern und unsachgemässen Umgang mit Datenschutz zu vermeiden, benötigt der Nachwuchs ein grundlegendes Wissen zu Funktion, Nutzen und Risiken von digitalen Hilfsmitteln. Bei der Vermittlung dieser Medienkompetenz nehmen Eltern – neben der Schule – eine zentrale Rolle ein. Sie sollten ihre Kinder nicht nur über die verantwortungsvolle Nutzung von KI aufklären, sondern sie dabei auch aktiv begleiten und durch gemeinsames Ausprobieren darin fördern, Informationen und deren Quellen kritisch zu hinterfragen. «Der Umgang mit künstlicher Intelligenz gehört zu den Zukunftskompetenzen. Denn wer versteht, wo deren Potenzial und Grenzen liegen, ist weniger anfällig für Manipulationen und kann die digitale Welt mündig mitgestalten, anstatt nur zu konsumieren», betont Sidonia Zwyssig, Fachperson für Medienbildung und Informatik an den Schule Gaiserwald und Bischofszell.
Dialog mit der Schule
Bei Hausaufgaben oder Projektarbeiten geben die Lehrpersonen meist vor, ob und in welcher Form digitale Werkzeuge eingesetzt werden dürfen. Insbesondere bei KI-Tools sollte dies nur in enger Rücksprache mit der Lehrkraft erfolgen. Entscheidend ist, dass Kinder den Lernprozess in den Mittelpunkt stellen. Digitale Hilfsmittel sollten sie dort nutzen, wo dieser unterstützt wird. «Wer Lernprozesse durch Hilfsmittel abkürzt, trainiert seine Fähigkeiten zur Problemlösung und zum eigenständigen Denken nicht ausreichend. Der Lerneffekt geht verloren, insbesondere bei unreflektierter Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT», erläutert Zwyssig. Digitale Werkzeuge können eine wertvolle Hilfe sein, aber das Kind muss wissen, wie es diese sinnvoll, gezielt und datenschutzsensibel verwendet.
Datenschutz zu Hause
Beim Lernen zu Hause obliegt es den Eltern, ob und mit welchen verfügbaren Tools, inklusive KI, ihre Kinder arbeiten dürfen. «Im Idealfall nutzen die Schülerinnen und Schüler datenschutzkonforme KI-Tools wie etwa ‹fobizz› oder ‹schabi›, die speziell für Schulen entwickelt wurden», rät die Medienpädagogin. «Dann können die Kinder über einen digitalen Klassenraum auch zu Hause mit diesen arbeiten, wenn die Lehrkraft sie für ein Projekt freigibt.» Dies habe den Vorteil, dass keine Rückschlüsse auf die Namen und die IP-Adressen der Kinder möglich seien. Legen Eltern für ihre Kinder einen eigenen Account bei KI-Programmen an – denn bei vielen ist dies erst ab 16 Jahren erlaubt – sollten sie die Option «Daten für Trainingszwecke verwenden / Modell verbessern» deaktivieren. Dadurch werden Eingaben nicht zur Weiterentwicklung des Modells genutzt. Ausserdem sollte man darauf achten, in den Anweisungen an die KI – den sogenannten Prompts – keine konkreten persönlichen Angaben zu machen und hochgeladene Inhalte vorab zu anonymisieren.

Erklärhilfen
«Aktives Lernen bedeutet, sich bewusst mit einem Unterrichtsstoff auseinanderzusetzen. Dies bedingt, dass man ihn verstanden hat, auf möglichst individuelle Weise verarbeitet und klug wiederholt», erklärt Zwyssig. Dadurch falle es leichter, neu erworbenes Wissen abzurufen und anzuwenden. Für Verständnisfragen zu einer bestimmten Materie bieten sich – ergänzend zu den Schulmaterialien – passende Erklärvideos auf YouTube oder auf Plattformen wie etwa «studyflix», «simpleclub» oder «lehrer-schmidt» an. Die multimedialen Inhalte sprechen unterschiedliche Sinne an, erläutern Fachbegriffe und Zusammenhänge anschaulich und altersgerecht. Wer sein Kind bei der Suche nach geeigneten Videos begleitet, kann verhindern, dass sich das Kind verzettelt oder in dem Medium hängen bleibt.
Informations- und Ideensuche
Für das Recherchieren bieten sich Kindern bis zur 6. Klasse insbesondere Online-Kindersuchmaschinen wie «Frag Finn», «Helles Köpfchen» und das Kinderlexikon «Klexikon» an, die auf Kinderseiten wie etwa «geolino» verweisen. Ältere Kinder können bei ihrer Recherche auch auf komplexere Texte aus dem Internet zurückgreifen und sich diese von einer KI altersgerecht erklären lassen. Zudem lässt sich die KI dazu nutzen, um zu überprüfen, ob die Infosuche vollständig ist. Auch bei der Vorbereitung eines Vortrags können KI-Programme Kinder sinnvoll unterstützen, indem sie Anregungen für Schwerpunkte, Titel oder eine Gliederung, aber auch kreative Einstiege liefern. Wichtig ist jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler diese Vorschläge nicht nur verstehen, sondern auch kritisch überprüfen und daraus eigene Ideen entwickeln. Denn der eigentliche Lernprozess besteht darin, Inhalte selbstständig zu strukturieren und zu reflektieren. «Problematisch wird es», warnt Sidonia Zwyssig, «wenn Kinder Textbausteine der KI direkt übernehmen, da so die Eigenleistung verloren geht und Fragen des Urheberrechts offenbleiben.» Deshalb brauche es klare Regeln und die Haltung, KI nur als Unterstützung zu verwenden, nicht jedoch als Ersatz für eigenes Denken und Arbeiten.
Zusammenfassen und visualisieren
Um aus dem Schulstoff die wichtigsten Punkte zum Lernen herauszufiltern und zusammenzufassen, kann es hilfreich sein, Fotos von Schulbuchseiten, Arbeitsblätter und Mitschriften in ein offenes Textdokument zusammenzuführen. Geeignet hierfür sind optische Zeichenerkennungsprogramme (OCR), wie sie etwa in OneNote oder Adobe Acrobat integriert sind. Um ein Thema nach der Lektüre zu strukturieren, kann es nützlich sein, eine Mindmap zu erstellen. Durch das Visualisieren der inhaltlichen Verbindung von Sachverhalten lassen sich Zusammenhänge leichter erkennen. «Mit einem digitalen Hilfsmittel wie etwa der App ‹TeamMapper› können Mindmaps nicht nur farblich gestaltet werden, sondern es lassen sich auch passende Bilder oder Piktogramme zu Begriffen hochladen oder diese können mit Links zu Webseiten oder Dokumenten verknüpft werden», empfiehlt die Fachfrau. Geht es um das Verständnis komplexer Abläufe, kann das Zeichen eines Flussdiagramms helfen. Dadurch werden Kinder dazu aktiviert, Textaussagen zu filtern und selbst neu zu arrangieren. Mit der App «Excalidraw» etwa kann spielerisch ein digitales Flussdiagramm gestaltet und dies beliebig oft überarbeitet werden.
Interaktive Lernbegleiter
Mithilfe von lehrbuchspezifischen Programmen oder Apps wie «Anton» und «Quizlet» kann das Wiederholen von Lerninhalten sehr motivierend sein und Fortschritte sichtbar machen – unter anderem dank interaktiver Aufgaben und Spielelemente. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Kinder Aufgaben nur durchklicken, ohne den Inhalt aktiv zu verarbeiten. Dann bleibt der Lernerfolg aus. Kritisch wird es insbesondere, wenn es eher um das Sammeln von Punkten als um das Verständnis der gelösten Aufgaben geht. «Am besten ist deshalb eine gesunde Mischung», rät die Expertin: «Digitale Tools sorgen für Abwechslung beim Lernen. Sich analog aktiv mit der Schreibweise von schwierigen Vokabeln auseinanderzusetzen, Eselsbrücken zu bauen oder den Wortlaut mitzulernen – das alles hilft, sich Besonderheiten einzuprägen.»

Individuelles Feedback
Ein genereller Vorteil digitaler Lernhelfer ist, dass Kinder deren Feedback oft leichter annehmen als von Eltern oder Lehrpersonen, da sie keine Auswirkungen auf die persönliche Beziehung befürchten müssen. Benötigen Kinder Rückmeldungen zu selbst geschriebenen Texten, sollten sie diese jedoch zunächst eigenständig überprüfen. Erst in einem zweiten Schritt macht es Sinn, ein KI-gestütztes Tool einzusetzen. «Dabei sind Programme zu bevorzugen, die dem Alter und Sprachniveau angepasst sind und Hinweise oder Anregungen geben, anstatt Texte automatisch zu korrigieren wie etwa DeepL Write», so Zwyssig. Manche Schulen nutzen hierfür bereits die App «fellofish», die ebenfalls mit KI arbeitet, jedoch bislang noch keinen Login für zu Hause anbietet. Bei Mathematikaufgaben benötigen Schülerinnen und Schüler oftmals Unterstützung beim Finden des Rechenweges. Verstehen sie jedoch die Logik hinter diesem, können sie den Lösungsansatz meist auf andere Aufgaben übertragen. Als Ergänzung zu den Lernplattformen der Lehrmittel, kann die App «photomath» eine gute Unterstützung sein. Sie zeigt Schritt für Schritt den Lösungsweg von Aufgaben auf. Zum Üben zusätzlicher Beispielaufgaben sind etwa «Anton» oder «GeoGebra» hilfreich.
Die geduldige KI
Seit Anfang August dieses Jahres bietet ChatGPT in allen Versionen den sogenannten «Study mode» an. Bei dieser Funktion liefert die KI keine direkten Antworten, sondern stellt den Jugendlichen Verständnisfragen und gibt Hinweise, damit sie selbst Schritt für Schritt zur Lösung gelangen. Dabei ist die KI geduldig und passt ihre Vorgehensweise dem Alter, Wissensstand und Tempo des Jugendlichen an und kann sich an frühere Lernziele und -sitzungen erinnern und somit gezielter helfen. Der Jugendliche kann solange fragen, bis er einen Fachbegriff oder Zusammenhang wirklich verstanden hat. «Eine Sperre für den normalen Modus, die ausschliesslich von den Eltern aufgehoben werden könnte, ist bisher aber leider nicht vorgesehen», bemängelt Sidonia Zwyssig. «Digitale Lernhelfer, insbesondere KI-Programme, haben ein riesiges Potenzial, Kinder individuell beim Lernen zu unterstützen», resümiert die Expertin. «Es braucht jedoch Schutzmassnahmen im Umgang mit KI, damit weiterhin eigenständiges Denken sowie nachhaltiges Lernen gefördert wird.»
Auch Mütter und Väter können KI-Tools nutzen, um Lernstoff schneller zu überblicken. In NotebookLM von Google lassen sich die Unterlagen hochladen und dazu etwa eine Print- oder Audio-Zusammenfassung, ein Glossar der Fachbegriffe in einfacher Sprache, eine Mindmap, eine Zeitleiste oder ein Personenverzeichnis erstellen. So fällt es leichter, die Kinder gezielt zu unterstützen.





