
Shutterstock.com
Gesellschaft
Der Zwang zur Sterilisation
Die Geschichte der Zwangssterilisation in der Schweiz ist düster. Und sie zieht sich bis in die Gegenwart. Unsere Autorin Marah ist als Mutter einer Tochter mit kognitiver Behinderung davon betroffen.
Im 20. Jahrhundert wurden in der Schweiz, wie in vielen anderen Ländern, Menschen gegen ihren Willen sterilisiert. Besonders betroffen waren Frauen mit körperlichen, kognitiven oder psychischen Behinderungen, aber auch gesellschaftliche Gruppen wie Jenische, Sinti und Roma, Prostituierte sowie arme oder wohnungslose Frauen. Diese Frauen entsprachen nicht den moralischen Normen der damaligen Gesellschaft und galten als «unwert» oder «minderwertig». Einflussreiche Ärzte, Politiker und Theologen hielten Zwangssterilisationen für ein Mittel, um soziale Probleme wie Armut oder Obdachlosigkeit zu lösen. Oft wurde den Frauen nicht einmal gesagt, dass sie sterilisiert werden. Sie glaubten, dass sie zum Beispiel eine BlinddarmOperation hatten. Erst viel später kamen die Übergriffe ans Licht.
Seit 1981 sind Zwangssterilisationen in der Schweiz gesetzlich verboten. Heute wird grundsätzlich nicht mehr davon ausgegangen, dass es «minderwertige» Menschen gibt – dieser dunkle Teil der Geschichte scheint abgeschlossen. Doch das ist nur auf den ersten Blick so: Das aktuelle schweizerische Gesetz unterscheidet nämlich immer noch zwischen «urteilsfähigen» und «urteilsunfähigen» Menschen. Besonders betroffen sind davon Mädchen und Frauen mit schweren kognitiven Behinderungen: Ihre Sterilisation ist noch immer zulässig, wenn sie gemäss Erwachsenenschutzbehörde Kesb im Interesse der betroffenen Person vorgenommen wird oder nach der Geburt die Trennung vom Kind unvermeidlich wäre, weil die Eltern für das Kind nicht sorgen können. In der Schweiz ist es also nach wie vor möglich, dass gewisse Frauen und Mädchen ohne ihre Zustimmung sterilisiert werden.
Fehlende Selbstbestimmung
Als Mutter einer Tochter mit kognitiven Behinderungen beschäftigt mich die rechtliche Lage in der Schweiz besonders. Die Vorstellung, dass meine Tochter sich irgendwann in einer Situation wiederfinden könnte, in der ihre Stimme nicht gehört wird und ich vielleicht nicht mehr in der Lage sein werde, sie in ihren Interessen zu vertreten, ist erschütternd. Menschen mit Behinderungen haben in der Schweiz generell viel weniger Rechte als nicht behinderte Menschen. Überall wird Menschen wie meiner Tochter die Selbstbestimmung abgesprochen: Sei es bei der Schul- oder Ausbildungswahl, bei der Wahl zwischen selbständigem Wohnen oder Wohnen in einem Heim, bei der Mobilität in öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder eben in Bezug auf ihren Körper und ihre sexuelle Gesundheit: Ihnen wird sehr oft ihre Sexualität, Partnerschaften oder ein Kinderwunsch abgesprochen. Die Meinung, Menschen mit Behinderungen, insbesondere mit kognitiven, könnten nicht für ein Kind sorgen oder das Kind sogar schädigen, ist stark verbreitet. Kürzlich sagte mir eine Bekannte «solche Menschen dürften doch keine Kinder bekommen», als sie einen Artikel über eine junge Frau las, deren Mutter eine kognitive Behinderung hat. Was sie damit meinte: Menschen wie meine Tochter. Das Thema Kinderwunsch ist sehr komplex und herausfordernd – doch müsste der gesellschaftliche und rechtliche Ansatz nicht eher lauten: Welche Unterstützung brauchen diese Menschen, wenn sie ein Kind bekommen? Wie werden sie aufgeklärt und in ihrer Sexualität begleitet? Wie können Menschen mit kognitiven Behinderungen ernst genommen werden in ihrem Wunsch? Und wie können wir ihnen als Bezugspersonen erklären, dass ein Kind eine grosse Verantwortung bedeutet, den Körper beansprucht und weitere Herausforderungen bedeutet? Wie geht also Prävention? Wer kann sonst noch mitsorgen für ein Kind, wenn eines entsteht? Sexualaufklärung von Jugendlichen mit Behinderungen ist noch immer ein grosses Tabu – heilpädagogische Schulen haben keinen verbindlichen Lehrplan wie die Regelschule, Sexualkundeunterricht ist nicht vorgesehen. Auch in Heimen gehen die Meinungen dazu auseinander und hängen stark von Heimleitung und Personal ab.
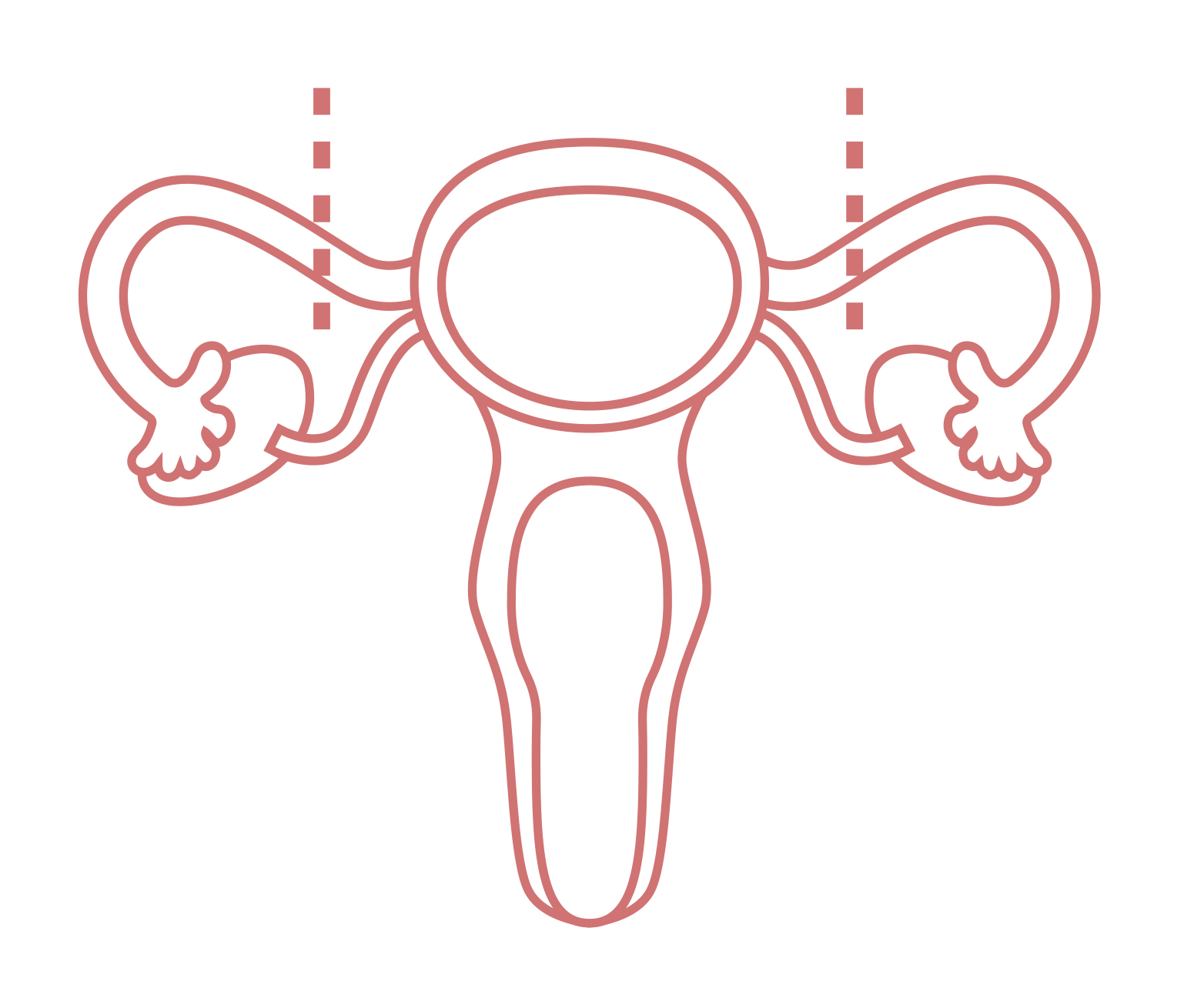
Marah Rikli, Autorin
UNO rügt die Schweiz
Die Schweiz hat vor zwanzig Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet, in der Praxis hinkt sie aber hinterher, wenn es um die Umsetzung dieser Rechte geht. Besonders Mädchen und Frauen mit Behinderungen erleben Diskriminierung. Sie haben oft keinen Zugang zu einer selbstbestimmten Sexualität und sind häufig Opfer von sexualisierter Gewalt. Studien zeigen, dass Mädchen mit Behinderungen zehnmal häufiger Opfer von Gewalt werden als andere Mädchen. Und sie haben weder die gleichen Reproduktionsrechte noch den gleichen Zugang zu einer gynäkologischen Versorgung. Ein riesiger Missstand.
Ein UNO-Ausschuss hat die Schweiz gerügt, was den Schutz von Mädchen und Frauen mit Behinderungen angeht und das Land zudem aufgefordert, Zwangssterilisationen von Menschen mit Behinderungen zu verbieten. Doch die Schweiz hat auf diese Forderung kaum reagiert. Im Jahr 2022 wurde daher die Petition «Stoppt Zwangssterilisationen» ins Leben gerufen, um diese Praxis endgültig zu beenden und Ansätze wie die Prävention anzustreben. Doch der Bundesrat verwies darauf, dass zunächst die Nationale Ethikkommission prüfen solle, wie weiter verfahren wird. Die Frage eines Verbots scheint keine hohe Priorität zu haben.
Auch Jan Habegger von «insieme Schweiz» fordert eine Reform des Sterilisationsgesetzes und sieht in der «unterstützten Entscheidungsfindung» eine mögliche Lösung für Menschen mit Behinderungen. Diese Unterstützung würde es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, bei schwierigen Entscheidungen wie einer Sterilisation, einem Kinderwunsch oder einer Abtreibung Hilfe zu bekommen, ohne ihre Selbstbestimmung zu verlieren. Und es gäbe auch weitere alternative Lösungen, wie die Unterstützung durch Sexualbegleiter:innen, die Menschen mit kognitiven oder motorischen Einschränkungen beim Umgang mit Verhütungsmitteln unterstützen. Weitere Lösungen könnten betreute Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen und deren Kinder sein, wie sie in Dänemark existieren.
Wunsch der Eltern aus Überforderung
In den letzten Jahren gab es Berichte über Frauen mit Behinderungen, die in Institutionen unter Druck gesetzt wurden, einer Sterilisation oder Abtreibung zuzustimmen. Viele betroffene Frauen wussten nicht, welche Auswirkungen diese Eingriffe auf ihr Leben haben würden. Die Zahl dieser Eingriffe bleibt unklar, da sie oft nicht gemeldet werden. «Die meisten dieser Eingriffe erfolgen auf Wunsch der Eltern, die oft überfordert sind mit der Sexualität ihrer Kinder», sagt Karin Huber vom «Netzwerk Avanti». Viele Eltern wünschen sich eine Sterilisation, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, was oft in einem sehr erschöpften Umfeld geschieht. In der Schweiz gibt es wenig Unterstützung für pflegende Eltern von Kindern mit Behinderungen, was den Druck auf diese Eltern erhöht, eine Sterilisation als vermeintlich einfachste Lösung zu wählen.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gesetzeslage bezüglich der Zwangssterilisationen in der Schweiz entwickeln wird für meine Tochter und viele andere Selbstvertreter:innen. Auch wenn ich als ihre Mutter vermutlich stark gefordert sein werde, falls sie sich ein Kind wünscht, bin ich für das Verbot der Zwangssterilisation. Sowohl die betroffenen Frauen und Mädchen als auch ihre Familien brauchen Unterstützung bezüglich Aufklärung, Verhütung, beim Finden ihrer Sexualität sowie bei einem möglichen Kinderwunsch. Dabei muss sich die Gesellschaft – insbesondere die Eltern von Menschen mit Behinderungen – die Frage stellen, ob sie wirklich bereit sind, ihre Kinder als gleichwertig zu behandeln.
Marah Rikli ist freie Autorin, Moderatorin, ehemalige Buchhändlerin und aktive Speakerin für Diversität und Inklusion. Sie lebt mit ihrer Patchworkfamilie in Zürich. Und lancierte kürzlich ihren eigenen Podcast Podcast Sara & Marah im Gespräch mit…






