
Joël Roth
Erziehung
Verlieren lernen - ist das wichtig?
Von Daniela Lukassen-Held
Es gibt kaum Schöneres als einen gemeinsamen Spielenachmittag mit der ganzen Familie. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem das Kind verliert – und seinem Ärger Luft macht.
Ein letztes Mal fallen die Würfel und die letzte rote Spielfigur wandert ins Ziel. Rot gewinnt und der Sechsjährige jubelt. Die kleine Spielerin mit der gelben Figur hingegen ist untröstlich.
Verlieren macht selten Spass, gehört aber zum Leben dazu. Wir alle kennen das Gefühl, wenn der Lieblingsverein den entscheidenden Ball verschiesst, wir in einer Diskussion feststellen müssen, dass wir mit unseren Argumenten nicht punkten können oder eben wir beim Spielen verlieren. Was wir Grossen mit etwas Anstrengung überspielen können, sorgt bei den Kleinen oft für Frust und Enttäuschung. Und das ist ganz normal. Denn wie so vieles andere im Leben müssen sie auch das Verlieren erst lernen. Dabei gibt es auch Phasen, in denen die Frustrationstoleranz mal grösser, mal kleiner ist. Verlieren fällt dann ganz besonders schwer, wenn die Entwicklung das Leben der Kleinen ohnehin gehörig auf den Kopf stellt. In der Autonomiephase zum Beispiel. Dann nämlich, wenn das Kind merkt: Ich habe einen eigenen Willen. In dieser Zeit beginnen die Kleinen damit, sich Ziele zu stecken und die eigenen Bedürfnisse durchsetzen zu wollen. Und das bedeutet fürs Spiel: Ich möchte mit meiner Spielfigur zuerst über die Ziellinie. Gelingt das nicht, sorgt das für Frust. Dass die Kleinen ihrer Enttäuschung über das verlorene Spiel lautstark Ausdruck verleihen, ist dabei nicht ungewöhnlich. «Verlieren zu können setzt voraus, dass ein Kind imstande ist, sich selbst zu regulieren mit seinen Gefühlen, Empfindungen und Impulsen», erklärt Erziehungsberaterin Ruth Feller. Und bis dem Kind das gelingt, ist es ein langer Weg.
«Diese sogenannte Impulskontrolle, auch Selbstdisziplin genannt, hat eine wichtige Funktion. Sie bringt uns dazu, zuerst zu denken und dann zu handeln. Die Hirnforschung zeigt, dass diese Fähigkeit sich erst ab circa drei Jahren langsam entwickelt und eng mit der Sprachentwicklung und dem Empathievermögen zusammenhängt», sagt Feller.
Gefühle ernst nehmen
Doch wie reagieren wir am besten, wenn Niederlagen für Gefühlsausbrüche sorgen und nicht nur die Würfel fallen, sondern im Anschluss ganze Spielbretter durch den Raum geworfen werden? Hilft da der berühmte Satz: «Das ist doch nur ein Spiel»? Eher nicht. Denn die Kleinen nehmen das Gewinnen, aber auch das Verlieren in dem Moment sehr ernst und die Niederlage persönlich.
Ruth Feller sagt: «Es ist wichtig, Verständnis zu zeigen für mögliche Reaktionen und die Gefühle dahinter ernst zu nehmen. Dies, indem man sie als Eltern benennt und sie nicht bewertet, sondern anerkennt und als Ausdruck einer womöglich schmerzlichen und kränkenden Erfahrung akzeptiert.»
Darüber hinaus gilt: Wenn das Kind verliert, müssen wir da gemeinsam durch, Mama, Papa und das Kind. Dabei hilft es, nach dem ersten Frust gemeinsam über das Erlebte zu sprechen. «Was hat dich so wütend gemacht?» zum Beispiel. Die Gefühle beim Namen nennen, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Und auch das Teilen von Verlierer-Erlebnissen kann dem Kind helfen, entspannter mit Niederlagen umzugehen. «Ich weiss noch, dass meine Schwester früher immer beim Memory gewonnen hat, da war ich auch enttäuscht» – Elternbekenntnisse wie dieses zeigen den Kleinen: Auch Mama und Papa verlieren hin und wieder – Niederlagen gehören zum Leben dazu.
Wie ein Kind verliert – ob es die Niederlage zwar geknickt, aber mit Fassung trägt oder ob es seinem Ärger über das verlorene Spiel lautstark Luft macht – ist übrigens kein Zufall. Hier spielen zum einen die Persönlichkeit eine Rolle, zum anderen auch wir Eltern. Oder vielmehr die Art, was für Verlierertypen wir selbst sind. Vom Modelllernen sprechen Expert:innen dabei. Das bedeutet: Unsere Kinder gucken sich ab, wie wir die Situation meistern und übernehmen unser Verhalten. Beim Wutausbruch eines kleinen Hitzkopfs nach einem verlorenen Spiel lohnt sich darum der Blick in den Spiegel.
Und ein Blick ins Spielregal. Denn damit Kinder lernen, auch mal zu verlieren, braucht es vor allem altersgerechte Spiele mit gleichen Chancen für alle und Regeln, die die Kleinen verstehen. «Es lohnt sich grundsätzlich, die Altersangaben bei Spielen zu beachten, um das Kind nicht zu über- oder unterfordern», erklärt Ruth Feller. Denn hat das Kind aufgrund seiner kognitiven Fähigkeiten überhaupt keine Chance zu gewinnen, sorgt das für Frust beim Nachwuchs.
Ruth Feller, Erziehungsberaterin
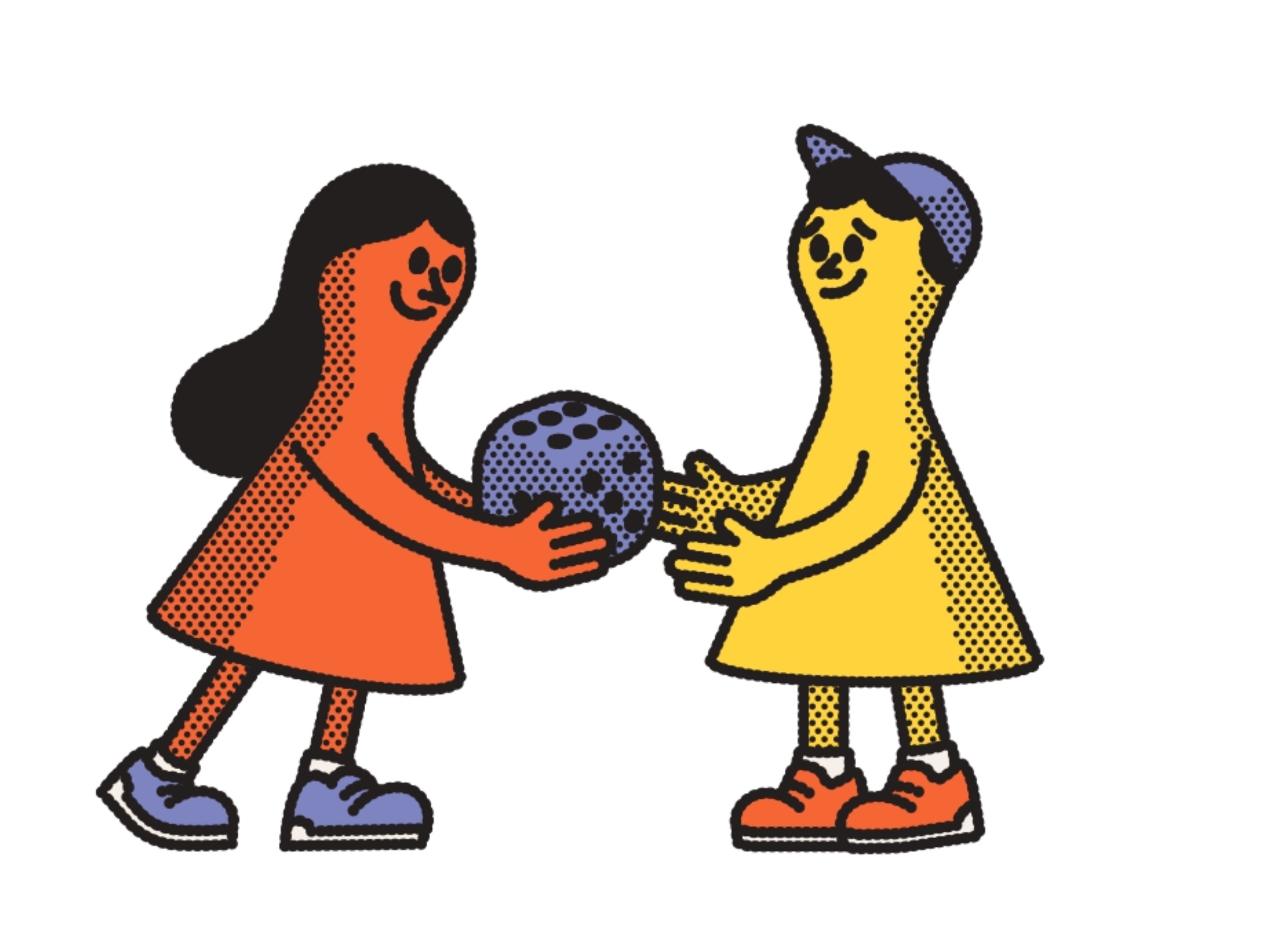
Altersgerechte Teamspiele
«Beim Spielen werden positive Emotionen – Gewinnen – und negative Emotionen – Verlieren – in schnell wechselnder Abfolge erlebt. Denn unabhängig vom Spielausgang, also der grossen Frage, wer gewinnt, lösen ja bereits einzelne Spielzüge und Spielmomente Gefühle von Gewinn beziehungsweise Niederlage aus», erklärt Thade Precht, Produktentwickler und -Designer bei HABA. Und er ergänzt: «Beim Spielen werden in einem klar definierten, sicheren Rahmen positive wie negative Emotionen durchlebt – ein sehr gutes Training für den Umgang mit Sieg und Niederlage.»
Neben altersgerechten Spielen können auch Kooperationsspiele einen wichtigen Beitrag leisten, wenn es um das Verlierenlernen geht. «Kooperative Spiele, also Spiele, bei denen man als Gruppe gemeinsam agiert, bieten einen sanften Einstieg in Sachen ‹Verlieren lernen›. Da hier eine potenzielle Niederlage auf mehrere Schultern verteilt wird, wird sie in der Regel als weniger frustrierend erlebt und die Gruppe mitunter noch mehr zusammengeschweisst – im Sinne von ‹Kommt, lasst es uns noch mal versuchen, beim nächsten Mal klappts bestimmt besser›», sagt Precht.
Auch Ruth Feller hält viel von Kooperationsspielen. «Bei kleineren Kindern sind Spiele, bei denen die Mitspieler:innen gemeinsam gegen etwas antreten, besser geeignet, zum Beispiel gegen den frechen Raben Theo im Spiel Obstgarten», sagt sie.
Und wie so oft macht auch beim Spiel Übung den Meister – auch, was das Verlieren betrifft. «Je mehr in der Familie zusammengespielt wird, umso mehr Erfahrungen macht das Kind mit allen möglichen Rollen in einem Spiel. Dies fördert auch die Sicherheit im Umgang mit der Verliererrolle, indem es sieht, wie die anderen Familienmitglieder damit umgehen», weiss Ruth Feller.
«Ich spiel nicht mehr!»
Doch was ist, wenn der Frust so stark wird, dass das Kind aus Angst vor dem Verlieren jegliche Wettbewerbssituation vermeiden möchte?
«Vielleicht einmal eine Zeit abwarten und anschliessend ein neues Spiel in der Bibliothek oder Ludothek ausleihen, welches das Kind auswählen darf», sagt Feller. «Hilfreich ist, in einer spielfreien Zeit in Ruhe mit dem Kind über seine Gefühle, Körperempfindungen, Gedanken während eines Spiels zu sprechen und dabei auch die Geschwister miteinzubeziehen.» So sei es sinnvoll, gemeinsam darüber nachzudenken, was dem Kind oder den Kindern helfen könnte. «Hier könnte man einen kleinen ‹Werkzeugkoffer› zusammenstellen, in dem sich zum Beispiel ein Knetball und eine Karte mit Klopfübungen befinden können, um sich zu beruhigen», sagt Ruth Feller. Ist das Kind wieder bereit zu spielen, rät die Erziehungsberaterin dazu, zu Spielen zu greifen, bei denen es um Teamarbeit geht. «Sinnvoll ist es auch, dem Kind zu helfen, indem ein Elternteil zusammen mit ihm gegen die anderen spielt. So kann der Erwachsene das Kind tatkräftig und emotional unterstützen.»
Gemeinsam verliert es sich nämlich besser. Und auch die Freude über das Gewinnen ist im Team meist noch grösser.
Apropos gewinnen: Häufig neigen wir Eltern dazu, beim Mensch ärgere dich nicht, eine Figur des Kindes absichtlich zu übersehen, die wir eigentlich rauswerfen könnten. Sollten wir unsere Kinder bewusst gewinnen lassen? «Manchmal kann es Sinn machen, das Kind gewinnen zu lassen. Nach einem Misserfolg, wenn zum Beispiel das mit dem Velofahren immer noch nicht klappt, kann es ein kleiner Trost sein, im Spiel zu gewinnen. Hier ist wichtig, dass Eltern ihrer Intuition, was ihr Kind gerade braucht, vertrauen», sagt Feller.
Das Kind ständig gewinnen zu lassen, ist hingegen nicht sinnvoll. Denn im gemeinsamen Spiel mit anderen Buben und Mädchen wird der Nachwuchs ganz selbstverständlich auch Niederlagen erleben. Bei einem Kind, das zu Hause gegen Mama und Papa immer nur gewinnt, sorgt das für Unverständnis und Unsicherheit.
Doch wie steht es eigentlich um die Verlierfähigkeit der Expert:innen? «Ich persönlich habe beim Spielen einen starken Ehrgeiz, zu gewinnen. Gleichzeitig halte ich mich aber auch für einen guten Verlierer. Unzählige Siege und Niederlagen waren bestes Training. Und vor allem: Meine Hauptmotivation beim Spielen ist nicht das Gewinnen, sondern das schöne gemeinsame Gruppenerlebnis», sagt Thade Precht.
Ein Aspekt, der immer im Mittelpunkt stehen sollte. Denn Spielen macht Spass und wer heute verliert, gewinnt vielleicht morgen.





