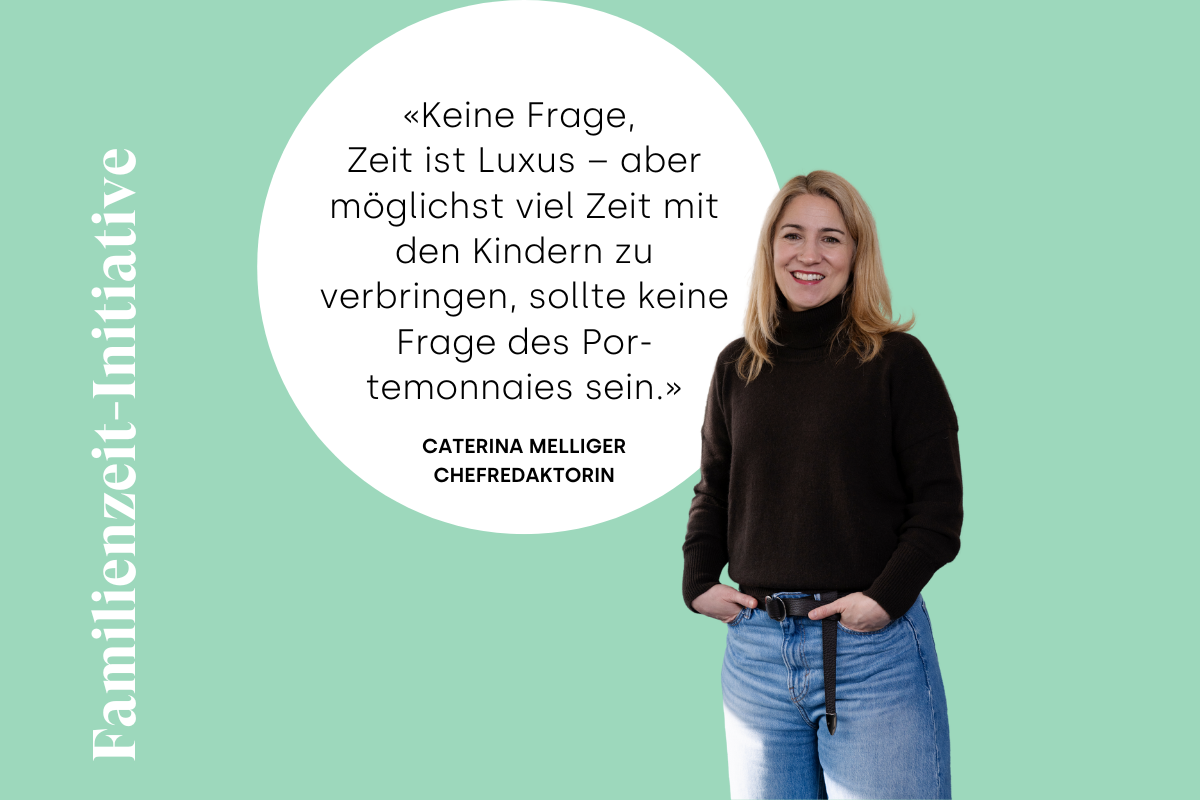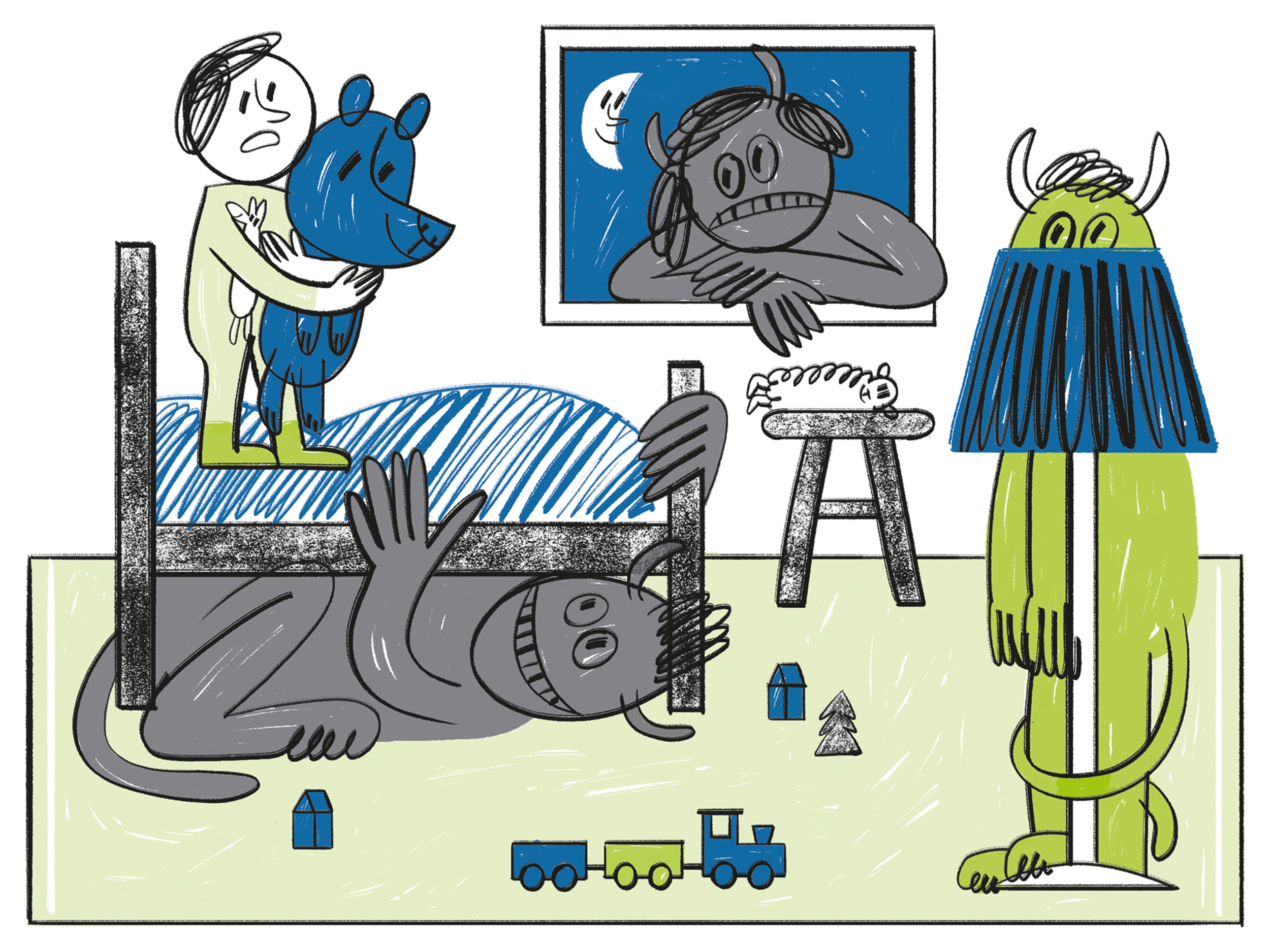istockphoto
Konsum
«Wir wollen dazugehören»
Der Wirtschaftspsychologe Christian Fiechter sieht im masslosen Shoppen auch eine ungenügende Selbstkontrolle.
wir eltern: Herr Fichter, wie sehr hängt eine gute Kindheit vom Geld ab?
Christian Fichter: Kaum. Die Basisbedürfnisse von Kindern hängen grundsätzlich von anderen Dingen ab: Geborgenheit innerhalb der Familie, Freundschaften und Erlebnisse verschiedener Art prägen eine Kindheit.
Und dennoch, noch nie haben Schweizer Eltern so viel Geld in ihren Nachwuchs investiert. Was treibt sie zu diesem Handeln?
Die Tatsache, dass wir alle Mitglieder einer Konsumgesellschaft sind, prägt unser Verhalten. Die Wissenschaft unterscheidet hierbei in drei Bereichen: Zum einen steht der Selbstausdruck jedes Einzelnen im Zentrum. Also, was will ich über mein Konsumverhalten ausdrücken, wie definiere ich mein ICH und das ICH meiner Kinder. Dann sind wir natürlich zweitens immer auch soziale Wesen. Es ist uns also wichtig, zu einer Gruppe dazuzugehören. Dies geschieht über den Erwerb bestimmter Produkte – Handys, Kleidung, Autos etc. Dieses Verhalten wird stark von der Werbung beeinflusst. Und drittens ist das Konsumverhalten auch immer in Abhängigkeit einer noch nicht ausgereiften Selbstkontrolle zu werten.
Heisst das, wir haben uns nicht genügend unter Kontrolle, oder wie ist das zu verstehen?
Sozusagen. Konsum, der über das Essenzielle hinausgeht, spricht meist auch unser Belohnungssystem an, welches uns vermeintlich vermitteln soll, dass wir gut sind, etwas gut gemacht haben und es deshalb verdienen. Menschen, die rauchen oder dem Alkohol verfallen sind, haben eine vergleichbare Grundmotivation für ihr Handeln.
Eltern wollen also mit einem übersteigerten Konsumverhalten ihre Kinder belohnen und zugleich sozial einbetten?
Könnte man so sagen.
Was aber, wenn man bei diesem «Spiel» nicht mitmachen will? Ist das überhaupt möglich?
Das wäre wünschenswert, ist aber ziemlich schwierig. Denn materielle Werte sind in unserer westlichen Gesellschaft zu dominant, als dass man sie vollumfänglich umgehen könnte. Allerdings lohnt es sich, eine Exposition zu vieler Güter zu vermeiden – beispielsweise wäre es besser, in der Vorweihnachtszeit mit den Kids schlitteln zu gehen, anstatt zum Shopping in die Einkaufszentren.
Das erscheint sinnvoll. Allerdings investieren Eltern ja nicht nur in materielle Güter, sondern auch in Dienstleistung, Kurse und dergleichen. «Nur das Beste für mein Kind» lautet dabei das Motto.
Das ist doch verständlich, oder? Schliesslich ist ein Kind ein hohes Gut. Es wird also niemand unterlassen, sein Kind in den Nachhilfeunterricht oder in die Gymivorbereitung zu schicken, wenn er oder sie es sich erlauben kann.
Was letztlich zu einer zunehmenden sozialen Ungleichheit führt, oder?
Das lässt sich nicht ganz bestreiten. Ich bin allerdings der Meinung, dass die Chancengleichheit in der Schweiz besteht. Die Ausgangslage ist allenfalls eine andere. Dennoch sollten wir nicht in einen Sozialpessimismus verfallen, das bringt uns nicht weiter. Ich plädiere eher dafür, sich alternative Lösungen näher anzuschauen – beispielsweise alternative Schulmodelle und dergleichen. Zudem sollten wir es politisch nicht unterlassen, einen gesellschaftlichen Wertewandel anzuschieben. Dafür braucht es allerdings Zeit.
Wie lange wird es dauern bis ein solcher Wandel eintritt?
Bis breite Gesellschaftsschichten ihre Werte überdenken, dauert es sehr lange, fürchte ich. Aber die ersten haben sich bereits auf den Weg gemacht.
Christian Fichter ist Wirtschaftspsychologe aus Zürich und beschäftigt sich innerhalb seiner Forschung unter anderem eingehend mit dem Konsumverhalten unserer Gesellschaft.